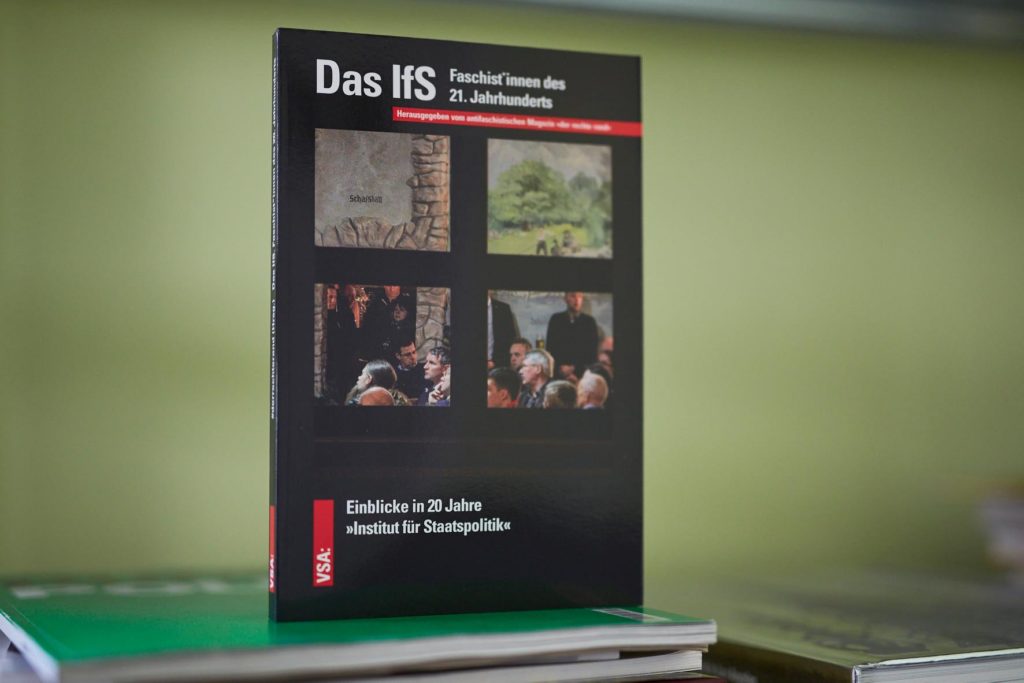Ärger mit der Querfront
von Lucius Teidelbaum
Antifa-Magazin »der rechte rand« Ausgabe 183 - September | Oktober 2012
Erstmals erschien die Zeitschrift »Compact« im Dezember 2010. Das am Kiosk erhältliche Magazin ist das Organ der Querfront-Truppe »Volksinitiative gegen das internationale Finanzkapital«, die sich 2009 um Jürgen Elsässer, den Chefredakteur des Blattes, formierte.



Anfänglich grenzte sich der Gründer und Chefredakteur der Zeitschrift »Compact«, Jürgen Elsässer, noch nach Rechtsaußen ab (s. drr Nr. 103, 104), als es 2006 die ersten kritischen Hinweise auf seinen Kurs nach Rechts gab. Mittlerweile zeigt er sich jedoch immer offener für die Rechte und paktiert mit Islamisten. So war er im April 2012 mit einer deutschen Reisegruppe im Iran, um an einer Privataudienz mit dem Präsidenten des Landes, dem Holocaustleugner und Islamisten Mahmud Ahmadinedschad teilzunehmen. Elsässer und seine Mitstreiter waren sich mit dem Autokraten sicher auch in ihrer Haltung zu Israel und dessen Einfluss in der Welt einig. 2009 rief die »Volksinitiative« zum Protest gegen den Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auf: »Am 30.11. findet in Berlin eine Veranstaltung der besonderen Art statt: eine gemeinsame deutsch-israelische Regierungssitzung. Wie darf man das verstehen? Ist Frau Merkel so nebenbei auch Kanzlerin Israels geworden? Und Herr Netanjahu so ganz nebenbei auch zum deutschen Premierminister avanciert?« Auf der Homepage von »Compact« heißt es dazu passend: »Wer den Begriff »Konzentrationslager« auf die deutsche Vergangenheit beschränkt, wird die Realität von Abu Ghraib und Guantánamo nicht beschreiben können. Wer vom »Zionismus« nicht reden darf, muss auch vom Faschismus schweigen.«
Das seit Anfang 2010 erscheinende Magazin »Compact« illustriert, wofür Elsässer und seine »Volksinitiative gegen das internationale Finanzkapital« stehen. Es ist ein Konglomerat von Verschwörungstheorien, rechtem Populismus, Geschichtsrevisionismus, Homophobie und Antifeminismus. Das Magazin versteht sich als ein »einzigartiges publizistisches Experiment« und als »Gegengift zur politischen Korrektheit, also zur Ideologie der Neuen Weltordnung, die in den Massenmedien und auch in der linken Presse zum unantastbaren Tabu geworden ist.«
Die Auflage des Blattes lag nach eigenen Angaben im Mai 2012 bei 12.000 Exemplaren. 1.700 Stück sind abonniert und 7.500 Hefte gehen an die Kioske, wovon aber nur etwa 2.800 tatsächlich verkauft werden. Die Werbung im Magazin zeigt, an wen sich das Blatt wendet. Es finden sich Anzeigen vom extrem rechten »Ares Verlag«, dem »neu rechten« Strategieblatt »Sezession«, dem rechtsesoterischen und rechtspopulistischen »Kopp Verlag« und der »Preußisch Allgemeinen Zeitung«. »Compact« selbst warb für sich und einen von dem Blatt veranstalteten Vortrag mit dem rechten EU-Gegner Karl-Albrecht Schachtschneider auch in der »neu rechten« Wochenzeitung »Junge Freiheit« (JF).
Mit seiner »Volksinitiative« und »Compact« versucht sich Elsässer an einer Sammlungsbewegung. Doch statt der erhofften Massen findet sich nur ein Narrensaum zusammen, der kaum unterschiedlicher sein könnte. Elsässers Truppe ist eine wilde Mischung aus Ex-Linken, enttäuschten Rechten, Verschwörungs-IdeologInnen, Marktradikalen und einigen Muslimen. Mit den Worten des Herausgebers ausgedrückt, sollen sich in dem Magazin »demokratische Linke und demokratische Rechte, intelligente Muslime und intelligente Islamkritiker, Occupisten und Teaparty-Gänger« sammeln. Auch in der friedensbewegten Szene versuchen Elässer und Co. AnhängerInnen zu rekrutieren. Nationalpazifistische Argumente, Antiamerikanismus, Israel-Hass und Verschwörungstheorien bieten die Grundlage, um in einem Teil der Bewegung an bestehende Denkstrukturen anzudocken.
Das Magazin setzt auf rechte, populistisch aufgemachte Titel wie »Schulfach Schwul – Die sexuelle Umerziehung unserer Kinder« (Nr. 9/2011), »Raubtier-Feminismus – Nein danke!« (Nr. 7/2011), Sarrazin »Der nächste Bundeskanzler« (Nr. 10/2010) oder »Grass? Hat Recht!« (Nr. 5/2012). Solche Themen sind anschlussfähig an die extreme Rechte. Mit seinem heterogenen Charakter ist »Compact« derzeit aber (noch) kein extrem rechtes Blatt. Es ist ein Scharnier zwischen der extremen Rechten und den angrenzenden Grauzonen.
Der politische Kern der »Compact« ist Nationalismus, was auch an der häufig verwendeten Ansprache der LeserInnen als »wir Deutschen« festzustellen ist. Das Schwerpunkt-Thema der letzten Hefte ist das Feindbild EU und die Forderung »Zurück zur D-Mark!« (Nr. 10/2011). Mit seinem D-Mark-Nationalismus will das Blatt in breiten Bevölkerungsteilen punkten. Einen Eindruck vom Anti-EU-Populismus der »Volksinitiative« konnte man am 9. November 2011 bei einem Vortrag bei der rechten Berliner »Burschenschaft Gothia« gewinnen. Sie hatte zu einem Vortrag zum Thema »Die Eurokrise – Ursachen und Verursacher« eingeladen. Der Referent war der Berliner Peter Feist von Elsässers »Volksinitiative« und Autor im »Kai-Homilius-Verlag«, wo »Compact« und Feists Buchreihe erscheinen. Feist versteht sich als »Kommunist« und »alter Dialektiker« und betonte: »Mein Gegner ist das internationale Finanzkapital, das hat sich seit der DDR nicht geändert«. Er behauptete: »Es gibt keine größere Macht als das internationale Finanzkapital«, eine »Finanzoligarchie« arbeite gar an der Zerstörung der Nationalstaaten. Weil Teile der Linken das nicht erkennen, hätte er sich von ihr abgewendet. Heute müsse man den »Nationalen Widerstand« gegen Brüssel organisieren und die »Nation (…) retten, nicht den Kommunismus vorbereiten«.
Die »Stärkung des deutschen Nationalstaats gegen die EU-Diktatur« ist für Feist eine der wichtigsten Forderungen an eine Partei, die er unterstützen könnte. Doch dafür sei man noch immer auf der Suche nach einem passenden Projekt. Die Partei »Die Freiheit« sei, so Feist, nicht die richtige. Einige seiner »konservativen Freunde« seien von der Partei wegen deren »Kotau in Jerusalem« wieder abgerückt, erzählte er. 2010 hatte der Vorsitzende der Partei, René Stadtkewitz, mit Vertretern europäischer Rechtsparteien Israel besucht und aus antimuslimischen Motiven mit rechten Israelis eine Kooperation begonnen. Ursprünglich hätten Elsässer und Co. die Gründung einer eigenen Partei geplant, berichtete Feist. In ihr sollten dann die rechte und neoliberale »Partei der Vernunft« (PdV), Teile von »Die Freiheit« und den »Freien Wählern Berlin« aufgehen. Die Gründung sollte eigentlich nach der Konferenz »Bürger gegen Euro-Wahn – eine Wahlalternative« der »Volksinitiative« am 28. Januar 2012 der Öffentlichkeit verkündet werden. Doch seit dem ist von einer Parteigründung nichts mehr zu hören.
»Rinks« und »lechts«
Für »Compact« schreiben AutorInnen von rechts wie von links. Niki Vogt aus Elbingen (Rheinland-Pfalz) verfasste unter dem Pseudonym »Josefine Barthel« den homophoben Leitartikel »Schulfach Schwul«. Ansonsten schreibt sie Online-Texte für den »Kopp Verlag«. Ebenfalls Autor von »Compact« ist Rolf Stolz aus Köln, Mitglied von »Bündnis90/Die Grünen« und regelmäßiger Autor einer Kolumne in der JF. Artikel von ihm erschienen auch in den rechten Blättern »Sezession«, »wir selbst« und den »Burschenschaftlichen Blättern«. Auch der JF-Autor Jan von Flocken schreibt in »Compact«. Mit Michael Klonovsky, einem Freund der »Neuen Rechten« und »Chef vom Dienst« beim »Focus«, gab er das Buch »Stalins Lager in Deutschland 1945-1950« heraus. Auch der regelmäßige Kolumnist von »Focus Money« und Gründer der PdV Oliver Janich ist Autor in Elsässers Blatt, ebenso der ehemalige Direktor des Bundesrates und niedersächsische Ex-Kultusminister Georg-Bernd Oschatz (CDU). Der Honorarprofessor an der Verwaltungshochschule Speyer hielt am 7. Oktober 2001 die Festansprache beim österreichischen »Ulrichsbergtreffen« von Veteranen der Wehrmacht und der Waffen-SS. Ein ganz anderer Autor der »Compact« ist Stephan Steins, Herausgeber der antizionistischen und antiamerikanischen Internetzeitschrift »Die Rote Fahne«. Er forderte einst einen »Schuss mehr gesunden Patriotismus und Konservatismus«. Und der Österreicher Hannes Hofbauer schreibt nicht nur für »Compact«, sondern auch regelmäßig für das antiimperialistische Magazin »Intifada« aus Wien. Der Islam-Konvertit und Anwalt Andreas Abu Bakr Rieger schreibt ebenfalls für »Compact« und ist Autor in deren Buchreihe (»Weg mit dem Zins«). Rieger ist Vorsitzender der muslimischen Konvertiten-Sekte »al-Murabitun« und Herausgeber der »Islamischen Zeitung«, die in ihrem Online-Shop auch die »Compact« anbietet. »Al-Murabitun« wurde in den 1970ern in Spanien gegründet und knüpft in Deutschland auch an das Gedankengut der »Konservativen Revolutionäre« der Weimarer Republik an. Auf der Jahresversammlung der radikal-islamischen »Kaplan-Bewegung« 1993 sagte Rieger: »Wie die Türken haben wir Deutschen in der Geschichte schon oft für eine gute Sache gekämpft, obwohl ich zugeben muss, dass meine Großväter bei unserem gemeinsamen Hauptfeind nicht ganz gründlich waren.«
ABO
Das Antifa Magazin
alle zwei Monate
nach Hause
oder ins Büro.
Das Umfeld
Hinter der »Compact« steht der nach seinem Verleger benannte »Kai-Homilius-Verlag«. 1994 als Verlag für Reiseführer gegründet, war das Unternehmen anfänglich eher links zu verorten. Der heute in Werder (Havel) ansässige Verlag bezeichnet sich selbst als »politisch nicht korrekt«. Für den Inhaber Homilius sei »das alte rechts-links-Schema unbrauchbar geworden«. Das Verlagsangebot ist stark antiamerikanisch, antizionistisch und verschwörungstheoretisch geprägt. Es gibt Bücher mit Titeln wie »Zionismus und Faschismus. Über die unheimliche Zusammenarbeit von Zionisten und Faschisten« oder »Ariel Sharon – ein hoffähiger Faschist«. Eine Video-Reihe von »Compact«, zumeist Mitschnitte von Vortragsveranstaltungen, vertreibt der »Schild-Verlag« aus Elbingen (Rheinland-Pfalz). Er warb für sein Sortiment per Anzeige auch in der JF.
Querfront
Die extreme Rechte in Deutschland beobachtet Elsässers Projekte mit Sympathie, wovon zum Beispiel positive Berichte in der JF oder der »National-Zeitung« (NZ) zeugen. So lobte die NZ die »Querfront gegen den Euro«. Auch organisatorisch ist »Compact« fest in den rechten Blätterwald eingebunden. Den Verkauf und das Anzeigen-Geschäft übernimmt der »Berliner Medien Vertrieb« (BMV). Er ist laut einer Anzeige in der JF aus dem Jahr 2008 ein »Auslagerungsprojekt« der »neu rechten« Wochenzeitung und organisiert den Anzeigen-Vertrieb für die JF, das marktradikale Kampfblatt »eigentümlich frei«, das erzkatholische Magazin »Komma« und das rechtslastige Mittelstandsmagazin »Der Selbstständige«. Auch mit dem Magazin »Unzensuriert« von dem Politiker der extrem rechten »Freiheitlichen Partei Österreichs« (FPÖ) und Mitglied der rechten »Wiener Burschenschaft Olympia«, Martin Graf, gibt es einen Austausch von Online-Bannern auf den Websites.
Die Überschneidung von Teilen der Linken und Teilen der extremen Rechten findet sich nicht nur in der AutorInnenschaft, sondern auch in der LeserInnenschaft. Laut einer LeserInnenumfrage, an der sich 2011 »mehrere hundert« Personen beteiligten, ist der typische Leser von »Compact« männlich (85 Prozent). 21 Prozent der LeserInnenschaft informieren sich außerdem mit der JF und anderen rechten Publikationen. Neun Prozent geben an, sie lesen die Tageszeitung »Junge Welt« oder andere linke Zeitschriften. Ob das aber schon für eine große Querfront reicht, ist fraglich.