Faszinierende „Angstmacher“
von Volkmar Wölk
Magazin "der rechte rand" Ausgabe 169 - November 2017 - Online Only
Reden mit Rechten, das fordern zur Zeit viele – auch Thomas Wagner, Autor des Buchs „Die Angstmacher. 1968 und die Neue Rechte“. Doch der Diskurs wertet sie nur auf. Für Strategien gegen die „Neue Rechte“ braucht es keine Selbstdarstellung ihrer Akteure, sondern kritische Analysen ihrer Entstehung. Eine Kritik.
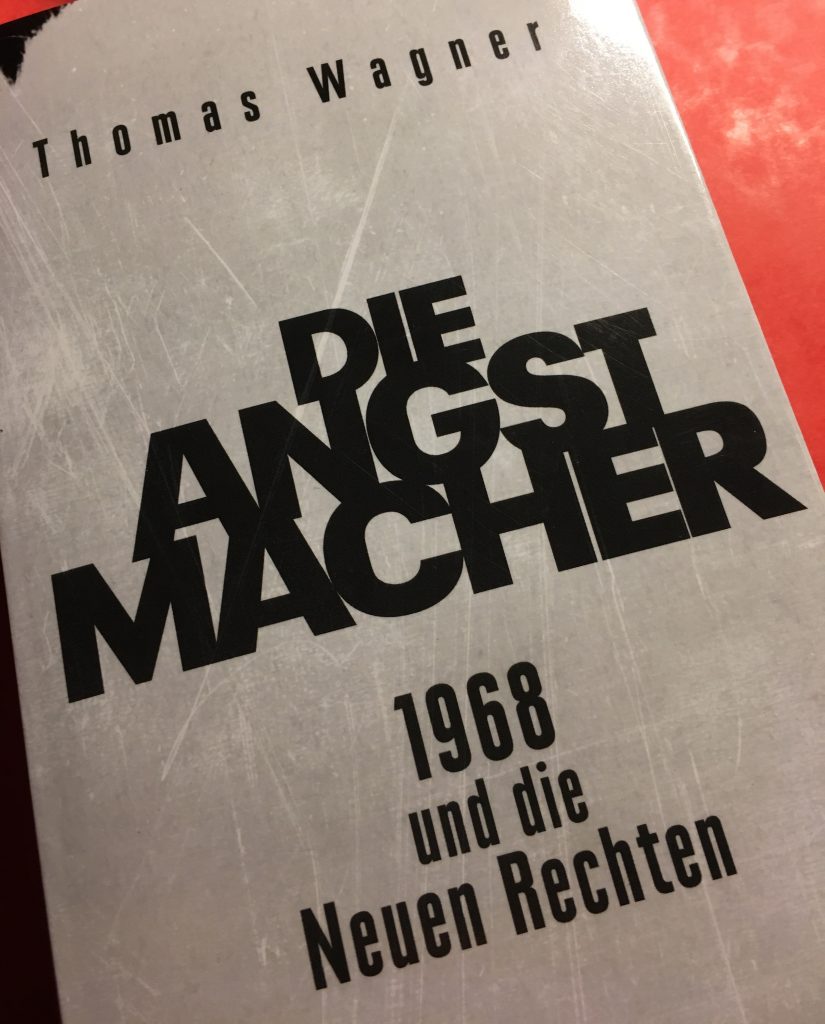
Buchtitel „Die Angstmacher. 1968 und die Neue Rechte“ von Thomas Wagner (Aufbau Verlag, 2017)
Manchmal sind es Kleinigkeiten, die bei einem Buch, das man gerade verschlungen hat, nachträglich zu einem Grummeln führen, das allmählich immer stärker wird. Beim Buch „Die Angstmacher. 1968 und die Neue Rechte“ von Thomas Wagner (Aufbau Verlag, 2017), einem sowohl sehr lesenswerten als auch sehr diskussionsbedürftigen Band, war der Auslöser dieses Unwohlseins ein Teil eines im Buch wörtlich wiedergegebenen Gesprächs mit Henning Eichberg, einem langjährig führenden Ideologen der nationalrevolutionären Strömung der „Neuen“ Rechten.
Die Kronzeugin
Die Passage des Gesprächt dreht sich um den Leserbrief „Die besseren Argumente“ einer „Thora Ruth“ an die in Argentinien durch den ehemaligen hohen NS-Funktionär Wilfried von Oven herausgegebene Zeitung „La Plata Ruf – La Voz del Plata“ (Nr. 65/1973). Wagner hält den Namen der Autorin für ein Pseudonym. Der Brief wird in der Fachliteratur immer wieder als kennzeichnendes Beispiel für die Kommunikationsstrategie der extremen Rechten zitiert. Nachgewiesen werden soll damit in der Regel, dass sich die rassistischen Inhalte der extremen Rechten auch bei dem sich als neu-rechts verstehenden Teil nicht verändert hätten, sondern dass die gleichen Aussagen lediglich moderner formuliert und unverdächtiger verpackt würden. Es handele sich um eine Art Mimikry – eine Täuschung über die wahren Absichten. Mit der richtigen Methode zur Entschlüsselung gelänge es allerdings, sie zu decodieren und den Gehalt freizulegen. Ziel des Einsatzes dieses Zitates ist der Nachweis, dass Veränderungen in der Ideologie der extremen Rechten nur behauptet würden. Durch Adaption linken Vokabulars solle die Linke als ideologischer Hauptgegner in die Irre geführt werden. Zugleich würden so mögliche Brückenschläge von rechts nach links im Sinne einer Querfront versucht werden.
Wagner konfrontiert Eichberg mit diesem Leserbrief und zitiert ausführlich daraus. Er vermutet, dass sich Eichberg, dessen Verwendung unterschiedlicher Pseudonyme in seinen diversen Publikationsorganen und nach Textsorten wechselnd bekannt ist, sich damals hinter der Tarnidentität „Thora Ruth“ versteckt hätte. Ein Indiz dafür war die Veröffentlichung des Artikels „Warum sind wir Sozialisten. Ein Diskussionsbeitrag zum Selbstverständnis der neuen Bewegung“ von Eichberg unter dem Pseudonym „Hartwig Singer“ im „La Plata Ruf“, der zuvor in der Zeitschrift „Neue Zeit“ (Nr. 4-5/1973 und Nr. 6-7/1973) der „Aktion Neue Rechte“ erschien. Die Organisation war keine genuine Organisation der „Neuen Rechten“, obwohl einige Strukturen und führende Vertreter dieser Richtung an dem Projekt beteiligt waren. Wesentlich handelte es sich um eine Abspaltung der NPD, der eine parlamentsfixierte Ausrichtung vorgeworfen wurde. Neben einer eher traditionalistischen Strömung der Partei fanden sich darin auch zahlreiche Anhänger einer aktionistisch-hitleristischen Strömung. Eichberg räumt ein, dass die Argumentation des Leserbriefes starke Ähnlichkeiten mit seinen damaligen Positionen aufweist, distanziert sich aber gleichzeitig von den strategischen Aussagen in dem Beitrag. Er habe so „nicht geschrieben und auch nie gedacht“. Er weist also den Verdacht der Mimikry von sich. Und: „Ich habe aber keine Ahnung, wer das gemacht hat.“ Wie jeder gründliche Autor hatte Wagner eine These aufgestellt und sich um ihre Überprüfung bemüht. Er hatte sich geirrt. Damit war für ihn der Vorgang beendet.
Das ist ebenso bedauerlich wie folgenschwer. Denn wenn es sich nicht um Eichberg selbst handelte, dann wäre anzunehmen, dass der Autor oder die Autorin zumindest von seinem Denken beeinflusst worden ist. Anderenfalls hätten diese Ideen zur damaligen Zeit quasi in der Luft gelegen, wären dort Allgemeingut ohne nachweisbaren Ursprung gewesen. Gerade nach dem Bestreiten der Urheberschaft des fraglichen Leserbriefs durch Eichberg wäre es also von Interesse und Bedeutung, die Person „Thora Ruth“ zu erkunden. Der implizite Verdacht der Mimikry gegen die „Neue Rechte“ fände nur dann einen Beleg, wenn die Urheberin zu diesem Spektrum gehört. Relevanz hätte dieser Beleg nur dann, wenn es nicht ein schlichter Einzelfall ist.
Der Name Thora Ruth ist kein Pseudonym. Das ist problemlos durch Recherche zu belegen. Zu Wagners Entlastung sei angemerkt, dass vor ihm auch andere renommierte Autoren den gleichen Fehler begangen haben. Den Spuren der Leserbriefautorin zu folgen wäre lohnend gewesen, denn ihre Geschichte und ihre Einbindung in ein Organisationsumfeld hätten Wagner eventuell zum Nachdenken über einige seiner mit viel Selbstbewusstsein und Verve vorgetragenen Hauptthesen veranlasst. So stimmt er zwar Volker Weiß in dessen Feststellung zu, dass es von der „Neuen Rechten“ „immer auch inhaltliche und personelle Brücken zur alten Rechten und insbesondere zum Kanon der Zwischenkriegszeit“ gab. Zugleich aber widerspricht er vehement dessen Relativierung der Einschätzung, bei der „Neuen Rechten“ handele es sich um ein „68 von rechts“, da diese nur Stilfragen erklären und ansonsten „keine tiefere Erkenntnis“ beitragen könne (Volker Weiß: Die autoritäre Revolte. Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes, 2017). „Das Gegenteil ist der Fall“, meint Wagner. „Auf das veränderte Auftreten kommt es gerade an.“ Dass der Stil Vorrang vor den Inhalten habe, wäre erklärungsbedürftig.
Die Geschichte von Thora Ruth und ihres Leserbriefes lässt zumindest an der Unbedingtheit dieser These zweifeln. Ruth, 1953 in Ulm geboren, studierte Biologie in Tübingen und später in Mainz. Ein Faltblatt des „Nationaldemokratischen Hochschulbundes“ (NHB) von 1975, für den sie auch in ihrer Mainzer Zeit aktiv war, weist sie als Kontaktperson für Ulm aus (Beilage zu den „National-politische Studien“, Nr. 1/1976). Inhaltlich werden ausschließlich hochschulpolitische Themen benannt, lediglich durch eine unverfängliche Karikatur werden „die Linken“ als Feindbild bestimmt. Zwar wurden damals 23 Hochschulorte mit NHB-Vertretungen aufgeführt, doch dürfte die reale Mitgliedschaft in der Organisation die Zahl 100 nicht wesentlich überschritten haben. Von den aufgeführten Funktionären spielt heute nur noch Thomas Salomon (NPD) eine Rolle. Andere waren herausgehoben aktiv, sind aber entweder verstorben oder nicht mehr sichtbar tätig. Niemand der aufgeführten Personen fiel im Zusammenhang mit der „Neuen“ Rechten auf – auch nicht Ruth. Noch während des Studiums schrieb sie 1975 den Aufsatz „Rassemischung – Wissenschaft und Ideologie“ in der „Neuen Anthropologie“, die Zeitschrift der „Gesellschaft für biologische Anthropologie, Eugenik und Verhaltensforschung“ Jürgen Riegers. Sie war keineswegs am Ethnopluralismus Eichbergs und seines Umfeldes ausgerichtet, sondern vertrat vielmehr einen wissenschaftsförmig argumentierenden biologistischen Rassismus. An diesem Umstand scheint eine Schwäche der Untersuchung von Thomas Wagner auf. Implizit geht er von „der Neuen Rechten“ aus und nicht von „den“ neuen Rechten in unterschiedlichen ideologischen Spielarten, mit länderspezifischen Spezifika und historischen Entwicklungsphasen, die teils gravierende ideologische Modifikationen beinhalteten.
„Rasse“, „Neue Rechte“ und alte Rechte
Trotz ihres biologischen Rassismus, der sich auch auf die einschlägigen NS-Theoretiker wie Hans F.K. Günther berief, könnte man die „Neue Anthropologie“ mit einiger Berechtigung in neu-rechte Zusammenhänge stellen, wenn man die Einbindung des Blattes in eine „rassistische Internationale“ (Michael Billig: Die rassistische Internationale. Zur Renaissance der Rassenlehre in der modernen Psychologie, Frankfurt/Main, 1981) berücksichtigt, die zu vielfältigen Überschneidungen sowohl mit dem Diskurs als auch dem Autorenstamm der französischen neu-rechten Zeitschrift „Nouvelle École“ der dortigen Hauptorganisation der „Nouvelle Droite“, des „GRECE“, führte. Dies jedoch ist als Indiz gegen Wagners These zu werten, dass das „veränderte Auftreten“ entscheidend für die „Neue Rechte“ sei. Offenkundig wurde mittels eines Netzwerkes – eben einer „rassistischen Internationale“ – an einer Modernisierung der durch die NS-Praxis diskreditierten rassistischen und eugenischen Theorien gearbeitet, damit die alten Inhalte in veränderter Form nutzbar wurden. Genau aus diesem Grund erfolgte 1972 auch die Umbenennung der bisherigen „Gesellschaft für Erbgesundheitspflege“ in die unverfänglicher klingende „Gesellschaft für biologische Anthropologie, Eugenik und Verhaltensforschung“. Auch der Namenswechsel der Zeitschrift erfolgte zu diesem Zeitpunkt. Bis dahin hatte sie unter dem Namen „Biologische Zukunft – Erbe und Verantwortung“ firmiert. Während das deutsche Blatt seine Ausrichtung nicht änderte und Rieger zum NS-Apologeten ohne jegliche Modernisierungsbestrebungen mutierte, erfolgten beim GRECE erhebliche Modifikationen der Ideologie hin zu einem kulturdifferenzialistischen Rassismus, die starke Ähnlichkeiten mit dem Verständnis von „Ethnopluralismus“ des frühen Henning Eichberg aufweisen. Eichberg war ab 1972 zeitweise deutscher Korrespondent der „Nouvelle École“. Damals war er neben Armin Mohler der wohl wichtigste deutsche Kontaktmann des GRECE. Die Anbindung an die „Nouvelle École“ scheint allerdings eher schwach ausgeprägt gewesen zu sein, da sich nur ein Aufsatz von ihm in der Zeitschrift nachweisen lässt.
Jürgen Rieger selbst, schon damals Kopf hinter dem Projekt „Neue Anthropologie“, nahm im Sinne der Netzwerkarbeit mehrfach an den „Sababurgrunden“, den regelmäßigen Treffen der sich herausbildenden, nationalrevolutionär geprägten deutschen „Neuen Rechten“, teil. Zwar unterschied sich sein biologistischer Rassismus deutlich von den unter dem Label „Ethnopluralismus“ herausbildenden Theorieansätzen der Nationalrevolutionäre, doch stand das gemeinsame ideologische Projekt der Popularisierung des Gedankens der Differenz von Menschengruppen im Vordergrund. Ein Bindeglied dabei war auch die vergleichende Verhaltensforschung im Verständnis des Nobelpreisträgers Konrad Lorenz, die die genetische Prägung menschlichen Verhaltens stark betonte.
Thora Ruth blieb im Umfeld Riegers. Sie heiratete den dänischen Arzt Hans Christian Pedersen, einen bekennenden Nationalsozialisten und engen Bekannten Riegers. Dieser unterstützte das Ehepaar auch juristisch mit ihrer lokalen Gruppierung „Arbeitsgemeinschaft Schönes Sörup“. In ihrem Wohnort Sörup in Schleswig-Holstein „erregten beide erstmals 1985 das Interesse der Öffentlichkeit, als sie eine Gedenkrede zum Volkstrauertag lautstark und handgreiflich störten, in der der Opfer des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus gedacht wurde“ (s. drr Nr. 8/1990). Aktivitäten im direkten internationalen Neonazi- und Holocaustleugner-Umfeld folgten. 1998 verließ das Ehepaar Deutschland in Richtung Südafrika. Zumindest publizistisch blieb Thora Pedersen, die sich inzwischen den Vornamen „Andrea“ zugelegt hatte, nach der Auswanderung aktiv. In den negationistischen „Vierteljahresheften für freie Zeitgeschichtsforschung“ vermutete sie hinter den Attentätern vom 11. September 2001 die USA selbst oder den israelischen Geheimdienst Mossad. Warum jemand wie Ruth, die fest in der alten und NS-geprägten Rechten verankert war, als Kronzeugin für eine neu-rechte Kommunikationsstrategie taugen soll, ist nicht nachvollziehbar.

Der NeoNazi Jürgen Rieger aus Hamburg im Schulungszentrum Hetendorf 13 in der Lüneburger Heide am 18.05.1996 begegnet Photojournalisten mit einer Axt.
Wege aus der Krise?
Der Vorgang ist Ausdruck einer komplizierten Gemengelage zu Beginn der siebziger Jahre, in der sich die deutsche extreme Rechte befand. Sie war gezwungen, Auswege aus einer doppelten Defensivposition zu finden. Einerseits war ihre eigene Offensive gescheitert, die mit der Vereinigung wesentlicher Teile der bis dahin zersplitterten extremen Rechten in einer gemeinsamen Partei, der NPD, begonnen hatte und zunächst erfolgreich mit dem Einzug dieser Formation in die meisten Landesparlamente fortgeführt worden war, dann aber zum entscheidenden Zeitpunkt, der Bundestagswahl 1969, scheiterte. Gleichzeitig sah sie sich mit dem Aufstieg einer sich von den sozialpartnerschaftlich ausgerichteten DGB-Gewerkschaften, SPD und der zuvor in die Illegalität gedrängten KPD deutlich unterscheidenden aktionistischen und theoretisch runderneuerten Linken konfrontiert, deren Diskurs in der Öffentlichkeit breiten Widerhall fand. Dieser Aufschwung kam nur wenige Jahre nach dem Entstehen dieser Neuen Linken, damals ebenfalls in einer strategischen Defensivposition der Kräfte am linken Rand der SPD, allgemein völlig unerwartet. Wagner beschreibt diese Aufbruchsstimmung in dem Unterkapitel „Was 1968 war“ und verweist darauf, dass der Erfolg dieser Bewegung auch darauf beruhte, dass sie ungewollt die Initialzündung für eine überfällige und dringend notwendige Modernisierung der Gesellschaft lieferte.
Wagner neigt allerdings dazu, lediglich das Schlüsselerlebnis „1968“ als Auslöser für das Entstehen einer „Neuen Rechten“ in der Bundesrepublik zu sehen. Mindestens ebenso einschneidend waren andere Faktoren wie die Bundestagswahl 1969, die die Bildung einer sozialliberalen Koalition aus SPD und FDP zur Folge hatte. Damit drohte eine außenpolitische Wende hin zu einer Entspannungspolitik gegenüber dem Ostblock inklusive der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, verantwortet von einem Bundeskanzler, der – Inbegriff des Schreckens! – aus einer linkssozialistischen Gruppe stammte und während der NS-Zeit emigriert war. Statt eines Aufschwungs des Nationalismus zeichnete sich also ein „nationaler Nihilismus“ ab. Ermöglicht worden war dieses Szenario ausgerechnet durch das starke und zugleich zu schwache Abschneiden der NPD, denn die neue Regierungskoalition hatte weniger als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten. Diese Faktoren bei der Beschreibung der Entstehung der „Neuen Rechten“ einfach weitgehend auszublenden, ist mindestens leichtfertig.
Thora Ruth suchte wie viele andere Aktive und Strukturen der extremen Rechten nach Auswegen aus dieser Doppelkrise. Dazu war sie auch bereit, Teile der noch im Entwicklungsstadium befindlichen Ideologie der Nationalrevolutionäre zu übernehmen: „Die Idee des Befreiungsnationalismus ist in ganz Europa – von Irland und der Bretagne bis zu den unterdrückten Völkern Osteuropas – auf dem Vormarsch.“ Das passte inhaltlich zum in Mode kommenden Regionalismus in Teilen der Neuen Linken, der sich in etlichen Publikationen niederschlug, sowie der dortigen marginalen Debatte um das Verhältnis von Marxismus und Nation, griff erstmals in dieser Phase Diskursstränge der „Neuen Rechten“ in anderen Ländern, speziell in Frankreich, auf, und war zugleich mit dem bisherigen Primat des Antikommunismus der alten Rechten durchaus kompatibel, auch wenn dieser Feind nunmehr als janusköpfiger verstanden wurde. „Wir wenden uns sowohl gegen den sowjetischen Panzerkommunismus als auch gegen den US-Dollarimperialismus“, hieß es bei Ruth. Zumindest in der nationalneutralistischen Traditionslinie der alten Rechten der Nachkriegszeit waren solche Formulierungen nicht neu, sie waren allerdings in der NPD der sechziger Jahre deutlich minoritär.
Wenige Jahre später sind diese Ansätze bei ihr weitgehend aufgegeben und durch einen neuerlichen Vorrang des Antikommunismus abgelöst: „Wer mit uns der Meinung ist, daß es endlich aufhören muß mit dem Kapitalismus und der Geldsack-‚demokratie‘ der CDU/CSU, FDP, SPD, mit Volksverdummung durch die Werbemaschinerie, Umweltvergiftung durch profitgierige Großkonzerne, Agententum a la Guillaume & Co. und Cliquenwirtschaft der Parteifunktionäre, Unterdrückung des Volkswillens durch Panzerkolonialismus, Politirrenhäuser für Andersdenkende, Mauer, Stacheldraht und Minenfelder – der sollte sich einmal näher über die Vorstellungen und Ziele des Nationaldemokratischen Hochschulbundes informieren“ (JoGu,Nr. 48/1978).
Uwe Sauermann, der NHB und Katalysator Ernst Niekisch
Kleinparteien wie die „Aktion Neue Rechte“ sowie die nationalrevolutionären Gruppen, die den alten Nationalneutralismus aufgriffen, übten unbestreitbar spürbaren Einfluss auf den Rest der NPD sowie besonders deren Unterorganisationen NHB und „Junge Nationaldemokraten“ (JN) aus, in denen sich hauptsächlich die relativ wenigen und geistig beweglichen Aktiven der Partei betätigten. Ohne dass dadurch diese Gruppen insgesamt neu-rechts geprägt waren, bestand ein längerfristiger, enger Diskurs, der etliche Funktionäre und Aktivisten beeinflusste. Es handelte sich um ein Wechselspiel aus Konkurrenz und Kooperation.
Ein Beispiel dafür ist der 1974 gewählte Bundesvorsitzende des NHB, Uwe Sauermann, ein ehemaliger Sprecher der radikal-völkischen Münchener „Burschenschaft Danubia“, der offenkundig stark von dem nationalbolschewistischen Theoretiker Ernst Niekisch beeinflusst war. Durch seine Autoren- und Herausgebertätigkeit sorgte er dafür, dass Niekisch innerhalb der extremen Rechten Nachkriegsdeutschlands einem breiteren Publikum bekannt und entgegen der bisher überwiegenden Lesart als Teil des eigenen Lagers verstanden wurde. Sauermann, „der wohl als erster im Lager der heutigen Traditionsrechten das ideologische Bündnis mit dem ‚nationalistischen Aufbegehren im linken Lager‘ empfahl“ (Arno Klönne: „Linke Leute von rechts“ und „rechte Leute von links“ damals und heute, in: „Blätter für deutsche und internationale Politik“, Nr. 1/1983), sorgte als Verantwortlicher für das Verbandsorgan „NHB Report“ dafür, dass durch entsprechende Beiträge in dem Blatt in der eigenen, ideologisch disparaten Organisation die Modernisierungsbestrebungen innerhalb der extremen Rechten popularisiert wurden.
Zugleich verwies er immer wieder darauf, dass es für eine nationalrevolutionäre Besetzung der „nationalen Frage“ durchaus Bündnispartner auf der Linken gebe. Geradezu genüsslich zitiert er Ausführungen von Thomas Schmid, ehemals Mitglied des SDS in Frankfurt, dann der Sponti-Gruppe „Revolutionärer Kampf“ und noch später der Redaktion der Zeitschrift „Autonomie. Materialien gegen die Fabrikgesellschaft“ aus dem Jahr 1978, zehn Jahre nach der Revolte, die auch eine tatsächliche Entnazifizierung der Bundesrepublik zum Ziel gehabt hatte: „Ich mag diese Unterwürfigkeit nicht mehr: von ausländischen Genossen nur akzeptiert zu sein, wenn ich mein eigenes Land verleugne. Das ist eine Sackgasse, das steht in der Tradition der imperialistischen Entnazifizierung durch die gottverdammten Yankees, die die Demokratie bei uns verordnet haben“ (zitiert n.: Criticón, Nr. 60-61/1980). Angesichts solch rasanter und verblüffender Positionswechsel, die im Falle Schmids zu leitenden Tätigkeiten bei den konservativen Blättern „Die Welt“ und „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ führten, stellt die damals führende Monatszeitschrift der extremen Rechten ,„Nation Europa“, „die fließenden Grenzen zwischen Nationalrevolutionären, die von der Jungen Rechten abstammen, und unorthodoxen Linken” als das eigentlich interessante Phänomen des politischen Wandels in der Bundesrepublik heraus und schlussfolgert: „Die westdeutschen Nationalisten stehen vor dem Problem, dass vielleicht einmal eine Situation eintreten kann, in der deutschlandpolitische Prioritäten den Verzicht auf gesellschaftspolitische Rechts-Links-Einordnung fordern“ (Nation Europa, Nr. 11-12/1982). Man kann solche und weitere von Sauermann zitierten Aussagen auch als Beleg dafür sehen, dass entgegen der Meinung von Thomas Wagner die Konvergenz der Positionen zwischen „Linken“ und „Rechten“ keineswegs prioritär auf „1968“ oder einen Ideologiewandel der extremen Rechten oder deren veränderte Kommunikationsstrategie zurückzuführen war, sondern durch die Übernahme genuin rechter Topoi durch einige Repräsentanten der Neuen Linken, besonders der nationalistischen Ideologie.
Am 17. Juni 1976 zog sich Sauermann als Bundesvorsitzender des NHB zurück. Er wolle sich „auf die ideologische und publizistische Arbeit konzentrieren“ (National-politische Studien, Nr. 6/1976). Das Vorhaben: „Im Rahmen ihrer Nachwuchswerbung beabsichtigt die deutsche Burschenschaft, sich mit einer eigenen Zeitschrift an die Oberklassen der Schulen zu wenden. ‚Junges Deutschland. Das Magazin für Politik und Kultur’ soll unter der redaktionellen Leitung von Uwe Sauermann vierteljährlich ab Juli die Schüler in das burschenschaftliche Leben einführen und auch schwerpunktmäßig Fragen der in der burschenschaftlichen Tradition stets betonten deutschen Einheit behandeln“ (Criticón, Nr. 39/1977). Es bleibt beim Plan. Verwiesen werden soll jedoch auf den Umstand, dass die gegenwärtig als neues Phänomen zu beobachtende starke Verflechtung von Burschenschaftern wie auch des Gesamtverbandes „Deutsche Burschenschaft“ mit der extremen Rechten auch in der damaligen Zeit keine Seltenheit war. So war zum Beispiel Henning Eichberg mehrfach Autor in den „Burschenschaftlichen Blättern“, war Referent bei herausgehobenen Veranstaltungen von Burschenschaften und trat sogar als Festredner bei der Jahrestagung des „Akademischen Turnbundes“ auf. Sauermann war zwischen 1982 und 1990 ständiger freier Mitarbeiter des „Bayerischen Rundfunks“, siedelte als Korrespondent während der Wende in die DDR über und gründete dort die „Fernsehproduktion Leipzig“. 2003 wurde Sauermann vom PDS-Vorstand eingeladen, im Rahmen des Neujahrsempfangs der Partei in Berlin seinen Film „Die Kinder von Bagdad“ zu präsentieren. Er stellte ihn dort auch in einer Gesprächsrunde mit seinem Co-Autoren Karl Höffkes, ebenfalls ein langjähriger Aktivist der „Neuen“ Rechten, vor.
Ein neuer Schlageter-Kurs?
Höffkes und Sauermann hatten bereits zwei Jahrzehnte zuvor zusammengearbeitet, als Autoren des Bandes „Albert Leo Schlageter. Freiheit du ruheloser Freund“, der im neofaschistischen Kieler „Arndt-Verlag“ erschienen war und mit Schlageter eine Ikone der gesamten extremen Rechten würdigte. Der Umgang mit Personen wie Schlageter, aktiv in mehreren Freikorps und frühes Mitglied der NSDAP, der von der französischen Besatzungsmacht 1923 wegen Sabotageakten auf die Infrastruktur im besetzten Rheinland hingerichtet wurde, unterstreicht die enge Lagerverbundenheit zwischen der alten und der „neuen“ Rechten. Während die alte Rechte, repräsentiert durch den „Deutschen Block“, noch Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Schlageter-Feiern zu dessen Todestag an seinem Grab durchführte („Studien von Zeitfragen“, Nr. 10/1963), würdigte ihn die „Neue Rechte“ als Vorbild in ihrer Presse: „Heute, 64 Jahre später, ist bei der Linken dies alles vergessen, wird Albert Leo Schlageter in ‚antifaschistischen‘ Liedern und Gedichten als ‚Mörder‘ und ‚Bluthund‘ beschimpft. Aber es gibt auch andere. Der Schriftsteller Martin Walser sieht in Schlageter weder den ‚käuflichen Landsknecht‘ noch den ‚Faschisten‘, sondern nennt seine Motive ‚idealistisch national‘. Walser hält ihn für einen ‚Braven‘, einen ‚Begabten‘, einen ‚Reinen‘, für einen, ‚der erzogen wurde, Höherem zu dienen‘. Von tiefer Religiosität zeugen auch die Briefe, die er an seine Eltern schrieb. Martin Heidegger sagte am 10. Jahrestag der Erschießung Schlageters in einer Rede als Rektor der Freiburger Universität: ‚Schlageter ist wehrlos und allein den größten und schwersten Tod gestorben.‘ Schlageter zu ehren, ist also gewiß mehr als nur eine Pflichtübung“ („Neue Zeit“, Nr. 2/1987; die von 1975 bis 1987 publizierte Vierteljahreszeitschrift „Neue Zeit. Forum für die Sache der Völker“ war ein nationalrevolutionäres Blatt und nicht identisch mit der oben zitierten gleichnamigen Zeitung der ANR). Die Person – oder besser: der Mythos – Schlageter ist bis heute ein „Erinnerungsort“, der alle Fraktionen der extremen Rechten eint. Während die „Freien Kräfte“ bis in das neue Jahrtausend hinein im Raum Köln/Aachen jährlich mit bis zu 200 Teilnehmenden des Idols gedachten, rühmt sich die „Marburger Burschenschaft Rheinfranken“ in ihrer „Fuxenkladde“: „Auch andere politische Einzelaktionen erregten Aufsehen: So zum Beispiel das s.g. ‚Schlageter-Flugblatt‘, mit dem wir im SS 1993 die vorbildliche Rolle von Albert Leo Schlageter aufzeigten.“
All diese Zusammenhänge hätte Wagner durch seinen Gesprächspartner Henning Eichberg während des Interviews erfahren können. Nicht nur bei diesem Beispiel ist auffällig, dass kritische Interventionen oder solche, die zur besseren Einordnung des Geschilderten hätten dienen können, unterbleiben. Es entsteht der Eindruck, Wagner sei durch die porträtierten „Angstmacher“ ganz und gar nicht verängstigt, sondern vielmehr in einem Maße fasziniert, dass dies der Analyse schadet.
„Die nationale Frage als revolutionärer Störfaktor“
Ihm entgeht auf diese Weise, dass der Modernisierungsschub ab Ende der sechziger Jahre breite Kreise der extremen Rechten erfasste und dass beileibe längst nicht alle der nach neuen Wegen Suchenden sich in Richtung einer wie auch immer gearteten „Neuen Rechten“ bewegten. Er unterlässt die Überprüfung seiner zentralen These, dass damit begonnen wurde, „von den Aktionsformen der Neuen Linken zu lernen“ (Klappentext). Er hätte sonst bemerkt, dass es wesentlich um eine Auseinandersetzung mit den Inhalten jener Neuen Linken ging, deren ideologischen Ansätze und strategischen Schlussfolgerungen für die extreme Rechte selbstverständlich ebenso ungewohnt und verblüffend waren wie für weite Teile der alten Linken. Ihm wäre aufgefallen, dass der Kern der Auseinandersetzung nach wie vor die „nationale Frage“ war, dass Hoffnung auf eine mögliche Zusammenarbeit jeweils dann aufkeimte, wenn sich Vertreter der Linken auf den Diskurs des Nationalismus einließen oder ihn gar bedienten. Obwohl die Nationalrevolutionäre bei seinen Exkursen in die jüngere Geschichte eine wesentliche Rolle spielen, vernachlässigt Wagner so den Umstand, dass es ein Merkmal dieser Phase war, dass die Wiederaneignung verschütteter linkssozialistischer Ansätze auf der Linken ihre Entsprechung in einem Theorieschub auf der Rechten hatte, die zur Nutzung nach Art eines Steinbruches von jeweils für geeignet erscheinenden Autoren des eigenen Lagers, nämlich der diversen Strömungen der Konservativen Revolution, führte.

Screenshot vom im
Antaios Verlag erschienen Niekisch-Buch:
“Gewagtes Leben. Erinnerungen eines deutschen Revolutionärs 1889 bis 1945”
Der Name Ernst Niekisch, der unverzichtbar für die Entwicklung des nationalrevolutionären Stranges der „Neuen Rechten“ im Nachkriegsdeutschland war, wird in Wagners Buch an keiner Stelle auch nur erwähnt, obwohl von Niekischs Leben und Arbeit auch durch Wagner umfassend porträtierte Vertreter der aktuellen „Neuen Rechten“ wie Benedikt Kaiser (s. drr 171) in beträchtlichem Maße zehren. Und nicht zuletzt bleibt somit völlig außerhalb Wagners Blick der bemerkenswerte Umstand, dass es bereits in der Phase vor „1968“ regelmäßige, intensive Kontakte zwischen der Berliner Gruppe des SDS und Niekisch gab. 1962 trat der alte Nationalbolschewist Ernst Niekisch der Förderer-Gesellschaft des SDS bei und kandidierte für deren Kuratorium. Ohne Übertreibung kann von einem Einfluss seines Denkens auf die Neue Linke gesprochen werden. Dies gilt auch, wenn der Behauptung Bernd Rabehls, die Beschäftigung mit der „Frage der nationalen Befreiung“ der Kolonialisierten habe dazu geführt, dass SDS und Neue Linke „deshalb die nationalrevolutionären Schriften von Ernst Niekisch und Bäumler van der Bruck (sic!) studiert“ hätten, „um eine Konzeption der nationalen Wiedergeburt des deutschen Volkes in eine linksrevolutionäre Tradition zu stellen“, mit Zurückhaltung begegnet werden sollte, denn Rabehls Erinnerung verändert sich deutlich im Laufe der Jahre. 2002, zum Zeitpunkt der Verfassung der zitierten Zeilen, war er bereits seit einigen Jahren in das Lager der extremen Rechten gewechselt, hatte also ein Interesse an der Interpretation, er habe gar keinen Bruch mit seiner Vergangenheit vollzogen, sondern lediglich an vorübergehend verschüttete Quellen angeknüpft.
Die Niekisch-Rezeption in der frühen Bundesrepublik war einerseits geprägt durch Publikationen, die dessen Rolle als rechter Konkurrent Adolf Hitlers relativierten oder gar ausblendeten, andererseits durch Interpretationen seiner Biografie, die seine führende Zugehörigkeit zu linken Organisationen und vor allem seine Verfolgung durch das NS-Regime in den Mittelpunkt stellten. Auch für den SDS, wie für die gesamte Neue Linke, nahm die „nationale Frage“ einen erheblichen Stellenwert ein. Personen, die durch Leben und Werk für die Suche nach einem „dritten Weg“ jenseits von Ost und West standen, fanden deshalb schnell Gehör in diesen Kreisen, die unkonventionellen Ansätzen gegenüber aufgeschlossen waren. Dies traf besonders auf Niekisch zu, der umstandslos dem eigenen Lager zugeschlagen wurde, zum Beispiel in dem von Peter Brandt und Herbert Ammon herausgegebenen Buch „Die Linke und die nationale Frage. Dokumente zur deutschen Einheit seit 1945“ (Rowohlt, 1981). Dort wurde Niekisch als eine der „abweichende(n) Stimmen aus dem sozialistischen und linksbürgerlichen Lager“ vorgestellt. Solche wechselseitigen Beeinflussungen von Neuer Linker und entstehender „Neuer“ Rechter bleiben außerhalb von Wagners Blick, obwohl sie genau das zentrale Themenfeld seiner Betrachtungen betreffen.
„Neue Rechte“ vor 1968
Und nicht zuletzt ignoriert Wagner, dass die deutsche „Neue Rechte“ zwar in den Jahren ab „1968“ einen beträchtlichen Aufschwung erlebte, aber einen deutlichen publizistischen und organisatorischen Vorlauf vor dieser mythischen Jahreszahl hatte. Aus der bündischen „Gefährtenschaft“ heraus war bereits 1963 die Zeitschrift „Fragmente“ entstanden, in der Ansätze neu-rechten Denkens transportiert wurden. Im März 1964 folgte die Zeitschrift „Junges Forum“. Zum Selbstverständnis hieß es: „JUNGES FORUM soll allen jenen volksbewußten Kräften offenstehen, die sich über neue Formen und neue Grundlagen Gedanken machen. Leute mit Vorurteilen, die gestrigem Erleben und Denken entspringen, sollen nicht angesprochen werden. (…) JUNGES FORUM will Organ einer neu entstehenden Anschauung und Lebenshaltung sein. Es will keine Dogmen verkünden, sondern zum Nach- und Mitdenken anregen und neue Ansätze aufzeigen.“ Wesentliches Ziel war also eine Abkehr von der dominanten NS-orientierten oder deutschnationalen Rechten. Sich selbst charakterisierte der Kreis um die Zeitschrift als „Solidaristen“.
Den Weg zu einer inhaltlichen Erneuerung und Modernisierung suchten gleichzeitig auch schon länger bestehende Kleinparteien der extremen Rechten wie die „Deutsche Gemeinschaft“ um den späteren Grünen-Mitbegründer und ersten Bundessprecher der Partei, August Haußleiter, der seine politische Laufbahn in der „Konservativen Revolution“ der Weimarer Republik begonnen hatte. Auch wenn der Politikwissenschaftler Richard Stöss treffend feststellte, „dass die Ideologie der DG/AUD trotz politisch-gesellschaftlicher Veränderungen in der Bundesrepublik und trotz äußerlicher Wandlungsprozesse auch der Partei selbst seit 30 Jahren substantiell unverändert ist“ (Richard Stöss: Vom Nationalismus zum Umweltschutz: Die Deutsche Gemeinschaft/Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher im Parteiensystem der Bundesrepublik, Springer, 1980), muss zugleich festgehalten werden, dass spätestens mit der Gründung der AUD 1965 – nicht zuletzt eine Reaktion auf die kurz zuvor erfolgte Gründung der NPD – ein Modernisierungsschub seiner Partei erfolgte. Dieser sollte neue Themenfelder und Zielgruppen erschließen, erfolgte teilweise inhaltlich parallel zur ideologischen Arbeit der nationalrevolutionären Kleingruppen und wies besonders der nationalneutralistischen Ausrichtung ein höheres Gewicht zu. Thomas Wagner gibt die Begegnung Henning Eichbergs mit Haußleiter am Rande der Demonstration der extremen Rechten gegen den Besuch des DDR-Ministerpräsidenten Willi Stoph 1970 in Kassel wieder. Er erwähnt, dass Eichberg Haußleiter „verehrte“. Dabei lässt er es bewenden. Nicht einmal der Versuch einer Erklärung, aus welchen Umständen diese Verehrung herrührte.
Wagner widmet dem Besuch von Stoph 1970 in Kassel und den Demonstrationen von rechts aus diesem Anlass unter der Überschrift „Ein neuer Anfang: Die Rebellion der Nationalisten“ zwar breiten Raum, sieht in den Vorkommnissen allerdings vor allem eine erste Emanzipation von den taktischen Vorgaben der NPD und betont die Neuartigkeit der Aktionsformen. So schildert er in diesem Zusammenhang auch, dass die DDR-Fahne nur wenige Schritte vom Konferenzgebäude entfernt heruntergeholt und anschließend zerrissen worden sei. Bei den Tätern habe es sich um „drei als Journalisten getarnte Rechtsextremisten aus Schleswig-Holstein“ gehandelt, einer von ihnen, Dietrich Murswiek, ein Mitglied des NHB. All dies ist ebenso korrekt wie der Hinweis, dass Murswiek später zum angesehen Staatsrechtsprofessor und CDU-Mitglied wurde, verfassungsrechtliche Gutachten auch für die Bundestagsfraktion der Grünen und der LINKEN verfasste. Trotzdem erfolgt eine entscheidende Verschiebung der inhaltlichen Perspektive, wenn Wagner zugleich ausblendet, dass die drei Täter Mitglieder der „Deutschen Jugend des Ostens“ (DJO) waren, Murswiek sogar ihrer Bundesführung angehörte. Die 1951 gegründete DJO war organisatorisch und personell eng mit dem „Bund der Vertriebenen“ verbunden, faktisch dessen Jugendverband. Nach Eigenangaben sollen ihm Anfang der siebziger Jahre 160.000 Jugendliche angehört haben. Die Militanz und die Aktionsformen reichten also weit über den Kern der extremen Rechten hinaus auch in etablierte Organisationen, aus denen es Übergänge zur NPD und deren Unterorganisationen gab. Niemand käme nun allerdings auf die Idee, der DJO und anderen beteiligten revanchistischen Gruppierungen auch nur eine Nähe zu „Neuen Rechten“ zu unterstellen.
Hier bei wikipedia.org weiterlesen.
Dietrich Murswiek
Blick auf das Vorbild Frankreich
Was für Deutschland nicht richtig ist, nämlich die Zuschreibung eines Impetus von 1968 auf die Herausbildung der „Neuen Rechten“, ist für Frankreich auch dann erst recht falsch, wenn Wagner behauptet: „Mit der Gründung des GRECE antworteten junge Rechte auf die Herausforderung durch eine Neue Linke.“ Wagner folgt der Darstellung von Alain de Benoist in seiner Biographie „Mein Leben. Wege eines Denkens“ („Edition Junge Freiheit“, 2014), wonach das Gründungstreffen des GRECE Anfang Mai 1968 in Lyon stattgefunden habe, die Anmeldung als Verein im Januar 1969 erfolgt sei. Letztere Einschätzung teilt die Wissenschaftlerin Anne-Marie Duranton-Crabol, erklärt jedoch, die Gründung durch 40 jüngere Rechtsintellektuelle sei bereits im Januar 1968 in Nizza erfolgt (Visages de la Nouvelle Droite. Le G.R.E.C.E. et son histoire, Les Presses de Sciences Po, 1988). Berücksichtigt man, dass bereits im Februar 1968 die erste Ausgabe der GRECE-Zeitschrift „Nouvelle École“ erschien und schon im März 1968 die erste Nummer der „Éléments“, damals als „internes Bulletin“ der Gruppe firmierend, dann erscheint ihre Datierung logischer. Sie ergänzt, dass die Gründung der Gruppe und ihrer Zeitschriften eine Reaktion auf die Einstellung einiger wichtiger Zeitschriften der extremen Rechten gewesen sei, an denen die Mitglieder der Gründungsgruppe beteiligt gewesen seien. Bei ihnen habe es sich um „die Generation des Algerienkrieges“ gehandelt, geprägt durch die in Frankreich teilweise militanten und sogar terroristischen Auseinandersetzungen um den Entkolonialisierungsprozess, speziell die Eigenstaatlichkeit Algeriens.
Diesem Urteil folgt Pierre-André Taguieff in seinem Standardwerk „Sur la Nouvelle droite. Jalons d’une analyse critique“ über die französische „Neue Rechte“ (Descartes & Cie, 1994). Auf die Frage, „Kann man die Schaffung des GRECE als eine Reaktion auf die Bewegung des Mai 1968 begreifen?“, antwortet Taguieff unmissverständlich: „In keinerlei Hinsicht. Es trifft zwar zu, dass der GRECE seine Statuten am 17. Januar 1969 hinterlegt hat, aber bereits im Herbst 1967 waren auf nationaler Ebene Kontakte zwischen Militanten der im Mai 1960 gegründeten Fédération des étudiants nationalistes (FEN; Vereinigung nationalistischer Studenten) aufgenommen worden.“ Die Gründung sei vielmehr die Reaktion auf eine Reihe von gravierenden Misserfolgen des nationalistischen Lagers gewesen, die mit dem Verbot der Bewegung „Jeune Nation“ im Mai 1958 begonnen hatten und vorläufig mit dem vollständigen Scheitern des REL bei den Parlamentswahlen des März 1967 endete. Diese Darstellung ist in der französischen wissenschaftlichen Literatur unstrittig.
„Selbstdarstellung“
Natürlich ist es richtig und nützlich, dass Wagner die Selbstdarstellung seiner Protagonisten wie Alain de Benoist nutzt. Aber diese Methode wird dann kontraproduktiv, wenn sie ohne die zusätzliche Heranziehung der relevanten Sekundärliteratur erfolgt. Dies gilt zumal dann, wenn für Biografien wie die von Benoist alternative Versionen vorliegen (Marie-Luise Christadler: Die ‚Nouvelle Droite‘ in Frankreich“, in: Iring Fetscher (Hg.): Neokonservative und „Neue Rechte“, Beck, 1983). Die Selbstbeschränkung auf die Version der porträtierten Akteure läuft Gefahr, das von diesen gewünschte Bild des Geschehens zu vermitteln, den subjektiven Eindrücken statt den objektiv nachprüfbaren Fakten zu folgen. Gerade der Lebensbericht Benoists in Interviewform, den Wagner heranzieht, bietet etliche Beispiele für dessen Tendenz, die eigene Bedeutung herauszustreichen und zu übertreiben, aus dem GRECE und der Nouvelle Droite insgesamt sein ureigenstes Produkt zu konstruieren. Langjährige wichtige Weggefährten, die sich im Streit getrennt hatten, wie Robert Steuckers oder Guillaume Faye, werden dabei in ihrer Rolle minimiert. Dies wäre dann ein nicht wesentlicher Mangel, wenn die Ausführungen Benoists auf seinen persönlichen Lebensweg beschränkt wären, wird aber ärgerlich durch den Umstand, dass Benoist für sich in Anspruch nimmt, kompetent und umfassend für die gesamte „Nouvelle Droite“ sprechen zu können.
Was also bleibt von Wagners Thesen? Nicht viel. Es bleibt eine flüssig und anschaulich geschriebene Darstellung, die sehr materialreich ist und nicht zuletzt durch die Interviews mit einigen wichtigen Akteuren Innenansichten dieser Szene bietet oder vielmehr hätte bieten können. Denn die Interviewtechnik des Autors ist nicht sehr ausgefeilt. Er lässt die Befragten erzählen, bohrt selten nach und hinterfragt in seiner anschließenden Darstellung das Gehörte zu wenig. Es ist nachvollziehbar, dass diese Vorgehensweise den Beifall der Betroffenen findet, er gegenüber anderen Analytikern der „Neuen Rechten“ wie Volker Weiß oder Andreas Speit positiv hervorgehoben wird. Besonders gefällt der neu-rechten Publizistin Ellen Kositza Wagners zentrale Überlegung: „Dabei stellte ich mir die Frage, ob es tatsächlich eine gute Idee sei, rechte Intellektuelle vom politischen Diskurs auszuschließen, wie es immer wieder geschieht. Ist der offen geführte Streit nicht der viel bessere Weg, mit ihnen umzugehen? Diejenigen, die eine solche Auseinandersetzung in der Vergangenheit suchten, wurden dafür von links meist scharf kritisiert“ (Ellen Kositza: Sind wir „Die Angstmacher“?, in: Sezession im Netz, 18.08.2017, www.sezession.de/57364/wagner).
„…bloß ein Schlag ins Gesicht.“
Natürlich kann man darüber diskutieren, ob ein solcher Diskurs mit Rechten sinnvoll ist. Ein Kriterium für die Sinnhaftigkeit ist selbstverständlich, wie der künftige Gesprächspartner selbst über Sinn und Nutzen eines Dialogs mit dem politischen Gegner denkt. Götz Kubitschek, Gesprächspartner von Thomas Wagner und einer der wesentlichen deutschen Protagonisten einer „Neuen Rechten“, schreibt in dankenswerter Offenheit: „Wozu sich erklären? Wozu sich auf ein Gespräch einlassen, auf eine Beteiligung an einer Debatte? Weil Ihr Angst vor der Abrechnung habt, bittet Ihr uns nun an einen Eurer runden Tische? Nein, diese Mittel sind aufgebraucht, und von der Ernsthaftigkeit unseres Tuns wird Euch kein Wort überzeugen, sondern bloß ein Schlag ins Gesicht“ (Provokation, Edition Antaios, 2007). Trotzdem plädierte Wagner in der „Berliner Zeitung“ für eine solche Debatte, denn es gebe dort auch „Leute, die sozialistisch orientiert sind und die linke Strategien und marxistische Literatur studieren. Für den fähigsten Mann auf diesem Gebiet halte ich Benedikt Kaiser, den Verlagslektor von Götz Kubitschek, dem Vordenker der Neuen Rechten. Er sagt, die Linke hat sich von ihren Kernthemen verabschiedet. Das betrifft insbesondere die SPD, die eine neoliberale Partei geworden sei, aber auch die Linke, die ihre klassischen Themenfelder wie die soziale Frage zugunsten einer kulturellen Identitätspolitik aufgeben hat. Eine Politik, die sich vor allem um die Minderheitenrechte kümmert und dabei die Nöte der abhängig Beschäftigten aus den Augen verliert“ (11.12.2017). Verklausuliert stimmt Wagner dieser Kaiser zugeschriebenen Analyse zu. Da ist es eigentlich fast schon nebensächlich, dass er hier Sozialismus, der stets egalitär ausgerichtet ist, mit den antikapitalistischen Konzeptionen der „Konservativen Revolution“, die immer und vor allem anti-egalitär sind, gleichsetzt, wenn er sich so unverhohlen fasziniert von einem Nachwuchs-Kader der „Neuen Rechten“ zeigt, der vor wenigen Jahren noch im Nahfeld militanter neonazistischer Gruppen aktiv war. Andreas Speit zitiert angesichts der laufenden Debatte um die Notwendigkeit eines Dialogs mit der „Neuen Rechten“ den französischen Historiker Maurice Olender, 1993 Mitinitiator des von 40 Intellektuellen veröffentlichten „Appel à la vigilance“ („Aufruf zur Wachsamkeit“). Der Hintergrund damals war eine in Frankreich beginnende „rot-braune Allianz“, die ebenfalls mit der Notwendigkeit einer demokratischen Streitkultur gerechtfertigt wurde: „Man kann über alles, aber nicht mit allen reden“ (s. drr, Nr. 169/2017).
Andreas Speit
„Man kann über alles, aber nicht mit allen reden“
Volker Weiss
»Die autoritäre Revolte«
Man kann auch darüber streiten, ob die Erderwärmung nicht auch positive Aspekte habe. Aber man sollte einen gepflegten politischen Diskurs mit der „Neuen Rechten“ zumindest dann vermeiden, wenn man keinen Begriff davon hat, was „Neue Rechte“ ist und war, welche Strömungen es in dieser Rechten gibt, wodurch sie sich unterscheiden und wo sie sich einig sind, wenn der Blick auf eine europäische Erscheinung wie die „Neue Rechte“ weitgehend national borniert erfolgt, gegenseitige Beeinflussungen der Szenen in den unterschiedlichen Ländern deshalb außerhalb des Blickfeldes bleiben, wenn die Verwurzelung in der rechten Stammkultur des jeweiligen Landes als Ursache für die spezifische Entwicklung ausgeblendet wird.
Man mag der Hoffnung sein, man könne durch einen Diskurs einzelne neu-rechte Exponenten auf den richtigen Weg bringen. Thomas Wagner scheint Henning Eichberg, dessen Biografie den Band wie ein roter Faden durchzieht, dabei vor Augen zu haben. Aber Eichberg ist in vielerlei Hinsicht ein Solitär, eine Ausnahmeerscheinung. Seine veränderten Positionen sind das Ergebnis eines jahrzehntelangen Prozesses, teilweise schmerzhafter Brüche, die auch das Ende langjähriger Freundschaften bedeuteten, die zu Distanzierungen bis über den Tod hinaus führten. Trotzdem: das Beispiel Eichberg zeigt, dass ein solcher Weg möglich ist. Die Erfahrung lehrt aber auch, dass nur sehr wenige bereit sind, ihn tatsächlich zu gehen. Natürlich kann man eine politische Strategie auf Hoffnungen gründen. Dann sollte man aber berücksichtigen, was der Preis ist, wenn diese sich nicht erfüllen.
Ein politischer Diskurs erfolgt nie ohne Zweck. Es reicht nicht aus, wenn das Ziel nur darin bestehen sollte, die Diskurspartner besser kennenzulernen. Das geht auch über die Lektüre ihrer Schriften, über Videomitschnitte ihrer Veranstaltungen und Aktionen. Momentan ist die politische und kulturelle Lage noch so, dass jeglicher öffentliche Diskurs mit Vertreterinnen und Vertretern der extremen Rechten – ob „neu“ oder nicht – deren Aufwertung bedeutet. Dies kann man in Kauf nehmen, wenn man die Gefahr als gering erachtet. Ich teile diese Auffassung nicht.
https://www.der-rechte-rand.de/abonnement/
