Gute Chancen in Karlsruhe und Straßburg
von Björn Elberling
Antifa-Magazin »der rechte rand« Ausgabe 205 - November | Dezember 2023
#AfD-Verbot
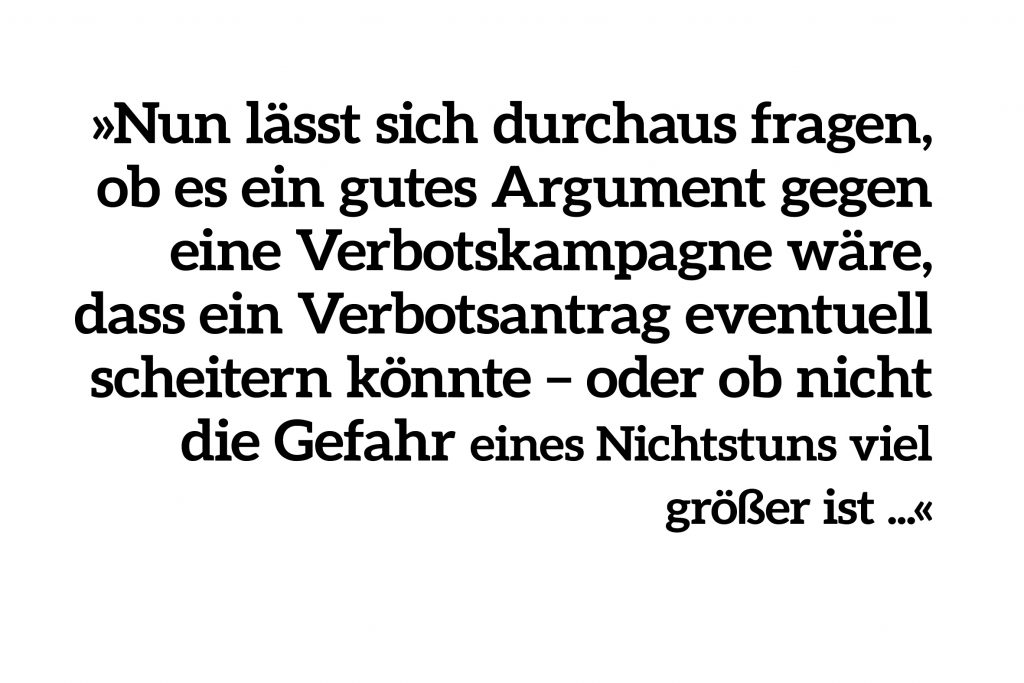
In der Diskussion um eine Kampagne für ein AfD-Verbot wird mitunter als Gegenargument eingeworfen, ein Verbotsantrag würde beim Bundesverfassungsgericht scheitern und/oder ein Verbot würde durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte aufgehoben werden. Mitunter wird dabei auf »schlechte Erfahrungen« aus den beiden NPD-Verbotsverfahren verwiesen.
Nun lässt sich durchaus fragen, ob es ein gutes Argument gegen eine Verbotskampagne wäre, dass ein Verbotsantrag eventuell scheitern könnte – oder ob nicht die Gefahr eines Nichtstuns viel größer ist, wenn viele Menschen angesichts einer befürchteten AfD-Regierungsbeteiligung auf den sprichwörtlich gepackten Koffern sitzen. Aber es spricht juristisch ohnehin sehr wenig gegen den Erfolg eines Verbotsantrags.
Karlsruhe I: keine schlechten Vorzeichen
So spricht zunächst nichts dafür, dass ein Verbotsantrag vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern würde. Es ist zwar richtig, dass es nach den zwei Parteiverboten gegen die nazistische »Sozialistische Reichspartei« 1952 und gegen die »Kommunistische Partei Deutschlands« 1956 keine weiteren erfolgreichen Verbotsanträge mehr gab, dass sogar insgesamt vier Verbotsanträge gegen neonazistische Parteien nicht zum Verbot führten. Aber keines dieser Verfahren spricht dagegen, dass ein AfD-Verbotsantrag Erfolg haben könnte.
ABO
Das Antifa Magazin
alle zwei Monate
nach Hause
oder ins Büro.
Den Verbotsantrag gegen die »Freiheitliche Arbeiterpartei« (FAP) wies das Bundesverfassungsgericht 1994 als unzulässig zurück, denn es sah sich schlicht nicht als zuständig an: die FAP sei mangels ausreichender Größe und Organisationsstruktur und angesichts erfolgloser und wohl eher pro forma erfolgter Teilnahme an Wahlen nicht in der Lage, eine parlamentarische Vertretung ihrer Anhänger*innen ernsthaft anzustreben. Sie sei daher keine Partei im Sinne des Grundgesetzes, sondern ein Verein. Für Vereinsverbote aber ist das Innenministerium zuständig, und dieses schritt dann auch 1995 zur Tat und verbot den Verein FAP. Ähnlich im Fall der Hamburger »Nationalen Liste« – kein Parteiverbot in Karlsruhe, dafür Vereinsverbot durch das Innenministerium. Diese Verbote läuteten den Anfang vom Ende neonazistischer Organisationen in »Parteien« ein, die Szene organisierte sich im Folgenden vor allem in für Verbote schwerer greifbaren »Freien Kameradschaften«. Zu den Erfolgsaussichten eines Verbotsantrags gegen die erfolgreiche Wahlpartei AfD sagen beide Entscheidungen nichts aus.
Und auch die beiden NPD-Verbotsverfahren, die nicht zum Verbot der Partei führten, sind kein Grund, ein Scheitern eines AfD-Verbotsantrags zu befürchten. Das erste Verbotsverfahren endete bekanntlich 2003 mit einer Verfahrenseinstellung durch das Bundesverfassungsgericht. Zahlreiche Parteifunktionäre bis in die Bundesführung waren zum Teil über Jahrzehnte als V-Leute geführt worden, einige noch während des laufenden Verbotsverfahrens. Einige der im Verbotsantrag zitierten Äußerungen der Partei stammten von diesen Personen. Und zu allem Überfluss war im Verbotsantrag diese fortbestehende Verbindung zwischen führenden Vertretern der zu verbietenden Partei und dem sie verbieten wollenden Staat nicht einmal offengelegt worden. Hieraus, so drei der Karlsruher Richter*innen, folge ein dauerhaftes Verfahrenshindernis – und da ein Verbotsantrag nur mit einer zweidrittel Mehrheit erfolgreich sein kann, reichte diese Sperrminorität aus, das Verfahren ganz zu beerdigen.
Eine vergleichbare Situation ist bei der AfD nicht zu befürchten. Denn zum einen wird die ja ohnehin erst seit kurzer Zeit von den Verfassungsschutzbehörden überwacht. Und zum anderen haben die Behörden ihre Lehren aus dem erfolglosen ersten NPD-Verbotsantrag gezogen, wie auch der erfolgreiche zweite Verbotsantrag aus 2013 zeigt.
Karlsruhe II: Maßstäbe gesetzt
Und dieser zweite Verbotsantrag sollte durchaus als Erfolg und als positives Vorzeichen für ein AfD-Verbot verbucht werden. Das Gericht lehnte es diesmal ab, das Verfahren wegen der V-Leute-Problematik einzustellen. V-Leute auf Führungsebene waren rechtzeitig vor dem Verfahren »abgeschaltet« worden; die Materialien, auf die der Verbotsantrag gestützt war, stammten nicht von V-Leuten; die fortbestehende Überwachung der Partei durch den Inlandsgeheimdienst diente nachweislich nicht der Ausspähung der Verfahrensstrategie im Verbotsverfahren. Den Fehler aus dem ersten Verbotsverfahren wiederholten die Landesregierungen, die über den Bundesrat den Verbotsantrag stellten also nicht. In der Sache entschied das Bundesverfassungsgericht zwar, die NPD nicht zu verbieten – dies aber nur deswegen, weil es sie letztlich als zu unbedeutend einstufte: Es erscheine angesichts der Schwäche der Partei nicht einmal als möglich, dass ihr verfassungsfeindliches Handeln erfolgreich sein könne, der NPD fehle es an »Potentialität«. Auch dies ist eine Feststellung, die man für die AfD angesichts ihrer Wahlerfolge nicht nur in den ostdeutschen Bundesländern – leider – nicht treffen kann.
Gleichzeitig ließ das Gericht keinen Zweifel daran, dass die NPD inhaltlich als verfassungswidrig einzustufen ist – und dass sie deswegen aus der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden kann. Vor allem setzte es Maßstäbe für die Verfassungswidrigkeit von Parteien, die gerade auch im Falle der AfD angewendet werden können. Denn es begründet die Verfassungswidrigkeit der NPD nicht mit der Lyrik der freiheitlich demokratischen Grundordnung (fdGO), sondern ganz zentral damit, dass die NPD-Politik völkisch-rassistisch und »auf die Ausgrenzung, Verächtlichmachung und weitgehende Rechtlosstellung von Ausländern, Migranten, Muslimen, Juden und weiteren gesellschaftlichen Gruppen gerichtet« ist.
Der Maßstab für ein Parteiverbot ist also maßgeblich auf den Schutz zentraler Menschenrechte von als »nichtdeutsch« eingestuften Personen, von Jüd*innen, von Menschen mit Behinderung, von LGBTQI und von anderen gefährdeten Gruppen ausgerichtet. Zu dieser menschenrechtlichen Fundierung passt es, dass die erste umfassende Überprüfung der AfD-Politik hieran vom »Deutschen Institut für Menschenrechte« stammt. Die im Frühsommer 2023 vorgelegte Broschüre »Warum die AfD verboten werden könnte« legt im Einzelnen dar, dass »die national-völkische Programmatik« der AfD derjenigen der NPD in keiner Weise nachsteht und dass daher auch die AfD die materiellen Maßstäbe des NPD-Urteils erfüllt. Jüngste Entwicklungen, wie etwa die Listenaufstellung für die Europawahl, bei der sich nahezu durchweg Kandidat*innen mit »Flügel«-Positionen durchsetzten, oder die im September 2023 im Bundestag kalt lächelnd vorgetragene Ankündigung »millionenfacher Remigration« durch den AfD-Abgeordneten Matthias Helferich bestätigen diese Einschätzung weiter.
Ein Verbotsantrag, der sich die Mühe macht, dies nachzuzeichnen und die Verfassungsfeindlichkeit der AfD anhand von Programm und Aussagen führender Politiker*innen aufzuzeigen, hat also hervorragende Aussichten auf Erfolg beim Bundesverfassungsgericht.
Straßburg: keine Gefahr für ein AfD-Verbot
Und ein Verbotsurteil, das auf diesem strengen und zugleich menschenrechtlich fundierten Maßstab beruht, wird sicher nicht am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte scheitern. Denn wie auch im NPD-Urteil ausführlich dargestellt, lässt der Menschenrechtsgerichtshof den Staaten deutlich mehr Spielräume beim Verbot von Parteien als es das Bundesverfassungsgericht tut. Dieser fordert , dass ein Parteiverbot einen zulässigen Zweck verfolge, etwa den Schutz der Menschenrechte von bestimmten Personengruppen – genau die Rechtspositionen also, die auch ein AfD-Verbot wegen der völkisch-rassistischen Politik dieser Partei schützen würde. Und er fordert weiter ein »dringendes soziales Bedürfnis« für ein Verbot, das insbesondere dann gegeben ist, wenn die Ziele der Partei mit den fundamentalen Grundsätzen der Demokratie und des Menschenrechtsschutzes nicht vereinbar sind. Hinsichtlich der Stärke der Partei und damit des richtigen Zeitpunkts für ein Verbot räumt der Gerichtshof den Staaten einen erheblichen Ermessensspielraum ein – sie müssen nicht warten, dürfen zum Schutz ihrer Bevölkerung nicht warten, bis eine Partei die Macht ergriffen hat und konkrete Schritte hin zu Maßnahmen unternimmt, die grundlegende Menschenrechte verletzen. Sie müssen auch nicht warten, bis eine Machtergreifung kurz bevorsteht. Auch hier dürfte der Maßstab des Bundesverfassungsgerichts zur »Potentialität« von Parteien mindestens so streng sein wie der des Gerichtshofs.
Schließlich und endlich betont der Gerichtshof in seinen Urteilen immer wieder, dass bei der Überprüfung eines Parteiverbots auch die historischen Erfahrungen und Entwicklungen in dem betreffenden Konventionsstaat zu berücksichtigen sind. Gerade diese Äußerung lässt es als kaum vorstellbar erscheinen, dass der Gerichtshof dann das Verbot einer Partei kippt, die gerade in Deutschland wieder Gesetze im Interesse einer völkisch-rassistisch definierten Volksgemeinschaft und unter Ausgrenzung und Entrechtung aller anderen erlassen und durchsetzen will.
Dr. Björn Elberling ist Anwalt für Strafrecht, Presse- und Urheberrecht.